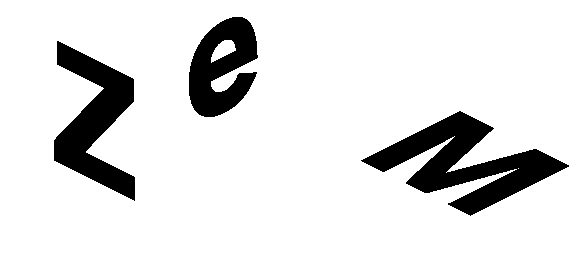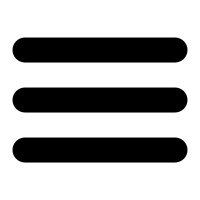07 January 16
Location
ZeM – Brandenburg Centre for Media Studies
Friedrich-Ebert-Straße 4
14467 Potsdam
Gamification and Involvement. Control policies and game
Announcer: There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. [BUZZER] You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. [MUSIC INTERRUPTED BY BUZZER] Good. Now please return to your bed.
Portal 2 (Valve/EA 2011)
Die operationale Praxis der gamification ruft den (eigentlich theoretisch obsolet gewordenen, bzw. immer falsch gesetzten) Begriff der „Immersion“ (als Involvierung) wieder auf. Gleichzeitig jedoch gewinnt das Konzept der Immersion hierbei neue Qualitäten – vor allem wenn wir es nicht länger als eine reine „Wirkungsdimension“ des Spiels (im Sinne eines „Hineingezogen-werdens“ in narrative und handlungsorientierte Settings) begreifen, sondern Immersion vielmehr als eine Subjekttechnolo- gie im Sinne Foucaults begreifen. Die Herstellung des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2007) oder die eher polit-pragmatische Dimension des nudging setzt eine ganz eigene Dynamik des „Hineingezogen-werdens“ frei. Insofern kann Immersion auch als ideologischer Effekt beispielsweise des Dispositivs Computerspiel begriffen werden – ein Effekt, der das Selbst-Management am Arbeitsgerät Computer im und durch das Spiel betont. Immersion (und gamification) können so als eine Form der Mensch-Technologie-Koppelung begriffen werden. Eine solche immersive Koppelung ist die Vorbedingung für die Herstellung eines willfährigen „ludifizierten Testobjekts“. Computerspiele können auf unterschiedlichen Ebenen als von diskursiven Mechanismen betriebene Maschinen verstanden werden, die ihre Funktionalität primär durch die Bereitstellung und Prozessierung von Adaptionsvorlagen gewinnen. Die menschliche „Ratte im Labyrinth“ wird also durch die Kraft der Diskurse, die Subjekte im Rahmen von Mikropolitiken an Spieler anschließt manufakturiert. Dabei sind es nicht nur Narrationstypen sondern auch Handlungs- und Steuerungsformen, die spielende Subjekte an symbolische und technische Systeme anschließen, und dabei diesen Anschluss zu einer „natürlichen“ Erfahrung überformen.
COORDINATION
Prof. Dr. Jan Distelmeyer, University of Applied Sciences Potsdam, EMW
Person
Prof. Dr. Rolf F. Nohr ist Professor für Medienästhetik/Medienkultur an der HBK Braunschweig. Er ist mit Britta Neitzel Gründer der AG Games in der Gesellschaft für Medienwissenschaft und Herausgeber der Reihe Medien’Welten (Münster: LIT). Arbeitsschwerpunkte sind mediale Evidenzverfahren, Game Studies und instantane Bilder. Er leitet aktuell das Forschungsprojekt Kulturtechnik Unternehmensplanspiel. Publikation z.B. (als Hrsg. mit Thomas Hensel u. Britta Neitzel) „The cake is a lie!“ Polyperspektivische Betrachtungen des Computerspiels am Beispiel von „Portal“ (Münster: LIT 2015).
Mehr unter http://www.strategiespielen.de, http://www.kulturtechnik.biz